Wo führt uns die AI noch hin?
Künstliche Intelligenz als Wegweiser für die Finanzwelt von morgen Der KI-Zug rollt – aber wohin?
Künstliche Intelligenz (KI) verändert unsere Welt – und die Finanzbranche steht im Zentrum dieses Wandels. Vom automatisierten Trading über personalisierte Finanzberatung bis hin zur Risikobewertung: KI ist längst mehr als ein Trend. Doch welche Entwicklungen erwarten uns in den kommenden Jahren? Und was bedeutet das für Anleger, Banken und Unternehmen? Wir haben hier einmal ein paar Punkte oder vielleicht Fragen zusammengestellt, die wir nicht vollständig beantworten werden – es ist eine Art Brainstorming.
1. KI als Anlageinstrument: Zwischen Datenflut und Prognosekraft
KI-basierte Algorithmen können in Sekundenbruchteilen Millionen von Datenpunkten analysieren – und daraus Anlageentscheidungen ableiten. Robo-Advisor wie beispielsweise der seit 2014 aktive Quirion (Quirin Privatbank) und KI-Trading-Systeme entwickeln sich rasant weiter. In Zukunft könnten sie nicht nur Trends erkennen, sondern auch makroökonomische Szenarien simulieren.
Frage: Wird der Mensch als Investor überflüssig – oder bleibt er die Kontrollinstanz?
2. Intelligente Finanzberatung: Individuell wie ein Maßanzug
Dank Natural Language Processing und Machine Learning wird Finanzberatung immer stärker personalisiert. KI-Systeme analysieren Verhalten, Präferenzen und Lebenssituationen, um individuelle Finanzstrategien vorzuschlagen – oft in Echtzeit. Banken setzen zunehmend auf hybride Modelle: Mensch und Maschine arbeiten zusammen. Die Integration von AI-Tools in Webseiten ist bereits sehr weit fortgeschritten und geht über das seit längerem bekannte Abarbeiten von Pfaden weit hinaus.
Chancen: Höhere Kundenzufriedenheit, effizientere Betreuung
Risiken: Datenschutz, Transparenz und ethische Fragen
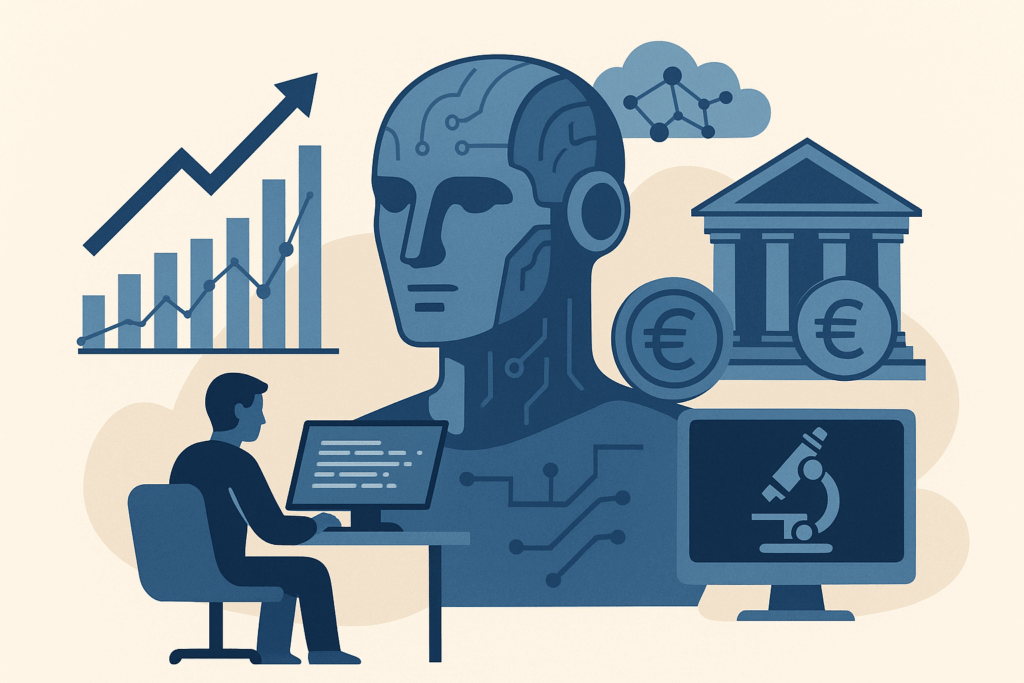
3. Betrugserkennung und Risikomanagement auf neuem Niveau
Cybersecurity, Kreditrisiken, Versicherungsbetrug – KI erkennt Muster, die dem Menschen verborgen bleiben. Mit einer solchen Anomalieerkennung und prädiktiver Analyse wird Risikomanagement präziser und proaktiver.
Ein Zukunftsszenario: Versicherer berechnen Prämien nicht mehr pauschal, sondern in Echtzeit – basierend auf dem Verhalten des Versicherten. Wobei – vielleicht passiert das ja bereits.
4. Makroökonomische Perspektive: KI als Treiber globaler Ungleichgewichte?
Während große Finanzinstitute massiv in KI investieren können, droht kleineren Marktteilnehmern ein Wettbewerbsnachteil. Auch geopolitisch entstehen neue Spannungen: Wer KI in der Finanzwelt dominiert, gewinnt Einfluss auf globale Kapitalflüsse.
Frage für Anleger: Wie lässt sich ethisch in KI-Infrastruktur investieren – ohne unerwünschte Nebeneffekte?
5. Fazit: KI ist kein Ziel – sondern ein Werkzeug
Die Frage „Wo führt uns die AI noch hin?“ lässt sich nur mit einem „Es kommt darauf an“ beantworten. Auf Regulierung (vor allem seitens der EU), auf Ethik, auf die Menschen, die sie einsetzen. Für die Finanzwelt bedeutet das: Die nächsten Jahre sind entscheidend. Wer KI sinnvoll integriert, kann profitieren – ökonomisch wie gesellschaftlich.
Kooperationen mit Universitäten sollen Wirtschaft stärken
Die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gilt als einer der wichtigsten Motoren für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. In Österreich gewinnen Kooperationen zwischen Universitäten und Unternehmen zunehmend an Bedeutung, um zukunftsweisende Entwicklungen zu fördern und den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken. Von gemeinsamen Forschungsprojekten über Technologietransfer bis hin zur Integration von Studierenden in den Berufsalltag bieten sich vielfältige Möglichkeiten, Synergien zu nutzen.
Vielfalt der Kooperationsmodelle zwischen Hochschulen und Unternehmen
Kooperationen mit Universitäten können in unterschiedlichen Formen stattfinden. Am weitesten verbreitet sind Forschungskooperationen, bei denen Hochschulen und Unternehmen gemeinsam an innovativen Lösungen arbeiten. Diese Projekte ermöglichen einen direkten Transfer von akademischem Wissen in die Praxis und fördern technologische Entwicklungen.
Daneben gibt es Auftragsforschung, bei der Unternehmen gezielt wissenschaftliche Expertisen in Anspruch nehmen. Auch die gemeinsame Nutzung von Laboren und Geräten oder die Einrichtung von praxisnahen Forschungszentren ermöglichen eine enge Zusammenarbeit. Für Unternehmen eröffnen sich dadurch Zugänge zu hochqualifiziertem Fachwissen, während Universitäten praxisrelevante Fragestellungen bearbeiten können.

Wirtschaftlicher Mehrwert durch Wissens- und Technologietransfer
Investitionen in die Zusammenarbeit mit Universitäten zahlen sich für Unternehmen langfristig aus. Die Entwicklung neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen wird durch den gezielten Einsatz wissenschaftlicher Ressourcen beschleunigt. Gleichzeitig steigert dies die Innovationsfähigkeit der Betriebe und stärkt ihre Wettbewerbsposition – sowohl national als auch international.
Darüber hinaus profitieren auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die häufig nicht über eigene Forschungsabteilungen verfügen. Durch strategische Partnerschaften mit Hochschulen können sie Zugang zu neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen erhalten, ohne hohe eigene Entwicklungskosten tragen zu müssen. Der Staat fördert solche Kooperationen vielfach durch Förderprogramme und steuerliche Anreize.
Werkstudenten als Brücke zwischen Universität und Wirtschaft
Ein besonders effektiver Weg, Universitäten und Unternehmen miteinander zu verknüpfen, ist die Beschäftigung von Werkstudenten. Diese Studierenden arbeiten neben dem Studium in Unternehmen und bringen aktuelles Wissen sowie frische Perspektiven mit. Gleichzeitig sammeln sie wertvolle Berufserfahrung und können theoretisches Wissen direkt anwenden. Ein Beispiel, von dem man hier lernen kann, ist die sehr erfolgreiche Arbeit der Hochschule Mainz, die langjährige Partnerschaften mit Firmen aus der Region im Rahmen eines Berufsintegrierendes duales Management-Studium unterhält.
Für Unternehmen bietet dies eine flexible Möglichkeit, Nachwuchstalente frühzeitig kennenzulernen und gezielt aufzubauen. Werkstudenten eignen sich hervorragend für projektbezogene Aufgaben oder zur Unterstützung bei Innovationsprozessen. Sie schlagen eine Brücke zwischen akademischer Forschung und unternehmerischer Praxis – eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
Erfolgreiche Praxisbeispiele aus Österreich
Zahlreiche österreichische Hochschulen pflegen enge Beziehungen zur Wirtschaft. In technisch geprägten Regionen wie Graz oder Linz haben sich Cluster gebildet, in denen Universitäten, Fachhochschulen und Unternehmen eng zusammenarbeiten. Beispiele sind gemeinsame Forschungsplattformen, Innovationslabore oder interdisziplinäre Studiengänge, die in Abstimmung mit der Industrie entwickelt wurden.
Auch in den Bereichen Biotechnologie, Digitalisierung oder erneuerbare Energien entstehen durch diese Partnerschaften wegweisende Projekte. Unternehmen profitieren von maßgeschneiderten Lösungen, während Studierende praxisnah ausgebildet werden und frühzeitig Karriereperspektiven erhalten. Sehr zielführend sind hier sogenannte Exit-Stipendien, bei denen Absolventen – meist Doktoranden – finanziell bei der Überführung im universitären Umfeld entwickelten Innovationen in den freien Markt unterstützt werden.
Internationale Anbindung und globale Innovationsnetzwerke
Kooperationen mit internationalen Universitäten erweitern den Horizont österreichischer Betriebe zusätzlich. Sie bieten Zugang zu globalen Forschungsnetzwerken, erleichtern den Wissenstransfer und fördern den Austausch von Fachkräften. Österreichische Unternehmen, die international agieren, können sich so an internationalen Standards orientieren und sich auf globalen Märkten behaupten.
Zudem ermöglichen solche Partnerschaften den Vergleich und die Übernahme bewährter Modelle aus dem Ausland. Der internationale Austausch fördert kreatives Denken und führt häufig zu Innovationen, die über den lokalen Markt hinaus Wirkung entfalten.
Zukunftspotenzial gezielt nutzen
Damit Kooperationen zwischen Universitäten und Unternehmen ihr volles Potenzial entfalten können, bedarf es eines strategischen Rahmens. Wichtig sind transparente Prozesse, verlässliche rechtliche Bedingungen und eine klare Zielorientierung. Auch eine stärkere Sichtbarkeit erfolgreicher Beispiele kann dazu beitragen, weitere Unternehmen für eine Zusammenarbeit zu motivieren.
Gleichzeitig sollten Studierende durch mehr Praxisangebote, wie Praktika oder Werkstudentenstellen, noch intensiver in Unternehmen eingebunden werden. So entsteht ein nachhaltiges Innovationssystem, das nicht nur technologischen Fortschritt ermöglicht, sondern auch zur Fachkräftesicherung beiträgt.
Fazit: Gemeinsame Stärke für Österreichs Zukunft
Kooperationen mit Universitäten sind ein wesentlicher Faktor für die Zukunftsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft. Sie ermöglichen Innovation, sichern Fachkräfte und fördern den internationalen Wettbewerb. Durch den Ausbau dieser Partnerschaften – sei es über gemeinsame Forschung, Technologietransfer oder die Beschäftigung von Werkstudenten – kann Österreich seine wirtschaftliche Stärke weiter ausbauen und aktiv die Herausforderungen der Zukunft gestalten.
Luxemburger Bankensektor wächst
Allen Unkenrufen über das Ende des klassischen Bankenmarktes zum Trotz gibt es in der EU noch Finanzplätze, die auch unter Coronabedingungen weiter wachsen. Das beste Beispiel hierfür ist der Standort Luxemburg, und hier lassen sich gleich mehrere Trends identifizieren, die musterhaft in der Entwicklung aufgegfriffen wurden und werden. Und das mit einigem Erfolg – etwa 51.000 Beschäftigungsverhältnisse im weiteren Finanzsektor sprechen für sich, hiervon etwa die Hälfte bei Banken im klassischen Sinne, die restlichen im Komplex Fondwirtschaft, Versicherungen und ergänzende Dienstleistungen (Stand 2019, Quelle: https://www.upside-recruitment.eu/de/).
Fokussierung, Clustering, Nachhaltigkeit, Digitalisierung
Um zu den „Megatrends“ zu kommen: Hier lassen sich vier erkennen, die zum Teil bereits seit Jahrzehnten bestehen.
- Fokussierung – Luxemburg hat seit den 1980er-Jahren systematisch auf die Entwicklung von Portfolios vermögender Privatanleger (Wealth Management) auf der einen Seite, innovativer und seinerzeit erst aufkommender Fondprodukte (etwa im Real Estate Bereich) gesetzt. In beiden Bereichen wurden steuerliche Vorteile bewusst eingesetzt, nicht immer legal, wobei sich das Problem der Steuerhinterziehung bzw. -vermeidung im Zuge der europäischen Integration entschärft hat. Nachdem hier eine Art „kritische Masse“ erzeugt war, setzte eine Eigendynamik ein die dazu führte, dass alle relevanten Finanzakteure in Luxemburg präsent wurden. Getrieben wurde dies in der Endphase auch durch das nun bereits entstandene Talentreservoir.
- Clustering – Mit der Fokussierung verbunden konzentrierten insbesonders Großbanken ihre entsprechenden Abteilungen gezielt in Luxemburg bzw. übernahmen oder gründeten eigene Bankhäuser (so eine Lizenz notwendig war) oder Fondsstrukturen.
- Nachhaltigkeit – Ein sehr aktueller Trend ist die Einstufung von Anlagemöglichkeiten als nachhaltig. Immer mehr institutionelle Anlager, aber selbst private Investoren legen hierauf Wert, (teil-)staatliche Investoren sind mitunter sogar gesetztlich dazu verpflichtet, einen gewissen Prozentsatz ihres Portfolios (oder komplette) entsprechend zu investieren.
- Digitalisierung – Luxemburg hat erkannt, dass eine zeitgemäße Breitbandinfrastruktur das A und O der Digitalisierung ist und liegt hier verglichen mit den deutschen oder britischen Wettbewerbern weit vorne.
Positive Aussichten
Nahezu alle Megatrends werden sich auch und gerade unter Coronabedingungen weiter fortsetzen. Luxemburg hat in diesem Zusammenhang ausgezeichnete Standortbedingungen und ein Momentum aufgenommen – gemäß „The trend is your friend“ – das es vermuten lässt, dass sich diese Entwicklung für die 2020er Jahre fortsetzen wird.
Ursachen für die griechische Staatsschuldenkrise
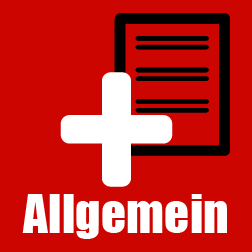 Regierende auf der ganzen Welt fürchten, dass Griechenland demnächst seine Schulden nicht mehr zurückzahlen kann. Es besteht die Gefahr, dass andere Länder diesem Konkurs folgen würden. Das Problem ist den Politikern klar – zu hohe Staatsschulden und die Lösung lautet – Reduktionen der Defizite. Wir machen uns auf der Suche nach den Ursachen der griechischen Finanzkrise. Einige stecken in das Verhalten von Regierungen und Institutionen, die sog. innergriechischen Ursachen, andere sind auf Geschehnisse im Bereich der EU selbst zurückführen.
Regierende auf der ganzen Welt fürchten, dass Griechenland demnächst seine Schulden nicht mehr zurückzahlen kann. Es besteht die Gefahr, dass andere Länder diesem Konkurs folgen würden. Das Problem ist den Politikern klar – zu hohe Staatsschulden und die Lösung lautet – Reduktionen der Defizite. Wir machen uns auf der Suche nach den Ursachen der griechischen Finanzkrise. Einige stecken in das Verhalten von Regierungen und Institutionen, die sog. innergriechischen Ursachen, andere sind auf Geschehnisse im Bereich der EU selbst zurückführen.
Hohe Staatsausgaben
Griechenland betreibt eine überdurchschnittlich expansive Haushalts- und Wirtschaftspolitik und verfügt über einen überdimensionierten und ineffizienten Staatsapparat. Dank der Vetternwirtschaft früherer Regierungen arbeiten über ein Viertel der griechischen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Außerdem geht der überdurchschnittliche Konsum nur mit unterdurchschnittlichen Investitionen einher.
 Griechenland hat hohe Militärausgaben. Wegen der Spannungen mit der Türkei sind diese bezogen auf das BIP größer als die der anderen EU-Länder. Auch die Truppenstärke ist überproportional hoch. Rüstungsgüter wurden insbesondere in den USA, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Russland gekauft.
Griechenland hat hohe Militärausgaben. Wegen der Spannungen mit der Türkei sind diese bezogen auf das BIP größer als die der anderen EU-Länder. Auch die Truppenstärke ist überproportional hoch. Rüstungsgüter wurden insbesondere in den USA, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Russland gekauft.
Geringe internationale Wettbewerbsfähigkeit
Bis zur Wirtschaftskrise hat sich das Pro-Kopf-Einkommen des Landes fast verdreifacht. Die Löhne im privaten und öffentlichen Bereich wurden bis zu 15 Prozent erhöht und die Lohnstückkosten steigen in den letzten Jahren enorm. Der Lebensstandard der Griechen ist zu hoch und entsprich bei Weitem nicht der Produktivität. Griechenlands Wirtschaft verliert dadurch an internationaler Wettbewerbsfähigkeit.
Finanzen
Griechenlands Schuldenkrise wurde jahrelang verschleiert, indem man Wirtschaftsdaten bzw. Statistiken schönte bzw. verfälschte. Das hängt auch mit den innergriechischen Strukturen zusammen. Das ist ein großes Problem, weil die Regierung ihre Finanzen nicht im Griff hat. Es gelingt ihr nicht, Einnahmen und Ausgaben richtig zu planen, zu überwachen und vorherzusagen. Bis heute gibt es keine funktionierenden Finanzbehörden, zumindest nicht im westeuropäischen Sinne.
Geringe Steuereinnahmen
Griechenland hatte in den Jahren vor der Krise einige Steuern gesenkt, was zu einer Verringerung der Staatseinnahmen führte.
Steuerhinterziehung
Die Steuermoral ist eine der großen Krankheiten des Landes. Keine Regierung hat es bisher geschafft, die Steuerhinterziehung effektiv zu bekämpfen.
Schattenwirtschaft
Griechenland lässt eine überdurchschnittlich große Schattenwirtschaft von geschätzten 40 Prozent des BIP zu. Geschätzt gehen dem griechischen Staat so jährlich mehr als 30 Milliarden Euro Steuereinnahmen flöten. Das ist ein europäischer Spitzenwert. Obwohl alleine die Eindämmung der Steuerhinterziehung einen Haushaltsüberschuss erzeugen würde und damit die griechische Finanzkrise hätte verhindern können, wurden die steuerpflichtigen Bürger von den Finanzbehörden nicht intensiver kontrolliert.
Korruption
Ungenügende Kontrollmechanismen bei Auftragsvergaben des Staates ermöglichten Korruption. Große und intransparente Projekte wurden initiiert und nur teilweise realisiert. In ihrem jüngsten Bericht von 2012 stellt „Transparency international“ fest, dass Griechenland beim Korruptionsindex (Corruption Perception Index, CPI) von Platz 78 auf Platz 94 von insgesamt 174 Ländern abgerutscht ist und damit innerhalb der EU-Länder den letzten Platz einnimmt, d.h. Griechenland hat die höchste Korruptionsrate in der EU.
Mangelnde Kontrollmechanismen seitens der EU
Die unsolide Fiskalpolitik Griechenlands und die unzureichenden Sanktionsmechanismen bei Vertragsverletzungen seitens der EU erhöhen das Risiko einer Finanzkrise in der Währungsunion. Die EU-Behörden haben trotz frühzeitiger Kenntnis der wirtschaftlich kritischen Lage von Griechenland über Jahre hinweg weder in wirksamer Weise das Verfehlen der Kriterien thematisiert, noch Gegenmaßnahmen getroffen. Bei den vertragswidrigen Abweichungen der griechischen Fiskalpolitik könnten die EU-Institutionen kaum direkt in die Fiskal- und Haushaltspolitik eingreifen.
Fazit: Typisch griechische Probleme
Die regelmäßigen Haushaltsdefizite führten zu einer stetigen Erhöhung der Staatsverschuldung, diese wiederum zu immer ungünstigeren Kreditkonditionen, zu denen Gläubiger noch bereit waren, frisches Geld zu verleihen. Sowohl die zunehmende Staatsverschuldung (Tilgungslasten) als auch die steigenden Zinsen belasteten den griechischen Staatshaushalt. Als die Leistungsfähigkeit der griechischen Wirtschaft und die Staatsverschuldung durch die Rating-Agenturen immer schlechter bewertet wurden, beschleunigte sich die Entwicklung hin zu immer höheren Kapitalkosten.
Forex Trading in Österreich – alternative Geldanlage?
Risikofreudig oder Sicherheitsfanatiker? Von Vorteil ist, dass es auf dem Markt für jeden Typus ein geeignetes Angebot gibt. In diesem Artikel werden sowohl sichere als auch spekulative Möglichkeiten zu Geldanlagen dargestellt.
Forex Trading als lukrative Anlagechance
Forex (Devisenhandel) beschreibt den Handel mit fremden Währungen. Das Traden hat in den letzten Jahren vor allem in den privaten Haushalten immens an Bedeutung gewonnen. Das Prinzip beim Trading ist relativ einfach: Man soll eine Spekulation auf Währungen tätigen. Erwartet man, dass der Dollar steigt, so sollte man das Guthaben von Euro in Dollar wechseln und abwarten, bis der Kurs sich entsprechend entwickelt – um zu einem späteren Zeitpunkt mit Gewinn in die Eurowährung zurückzutauschen.
Warum Forex Trading so beliebt ist
- Voraussetzungen sind PC, Internet und ein Account bei einem Broker, der die Transaktionen abwickelt
- Es müssen nur wenige Voraussetzungen erfüllt sein – Internet und PC, Startkapital (in der Regel 100 Euro ausreichend) und einen Forex-Account.
- Hoch spekulatives Geschäft – mit Forex Trading können relativ schnell extrem hohe Gewinne eingefahren werden.
Geringe Einsätze können bereits hohe Gewinne generieren
In der Regel setzt der Broker beim Einsatz des Traders einen Hebel ein (z.B. 100:1). Das heißt, dass er dem Teilnehmer ein Vielfaches des Einsatzes leiht und zur Verfügung stellt. Der Einsatz ist nur eine Art von Sicherheitsleistung, welcher als Margin bezeichnet wird.
Aktuelle Information uns psychologische Aspekte
Das Schärfen des Weitblicks ist enorm wichtig. Man soll die Wirtschaft und die Außenpolitik im Auge behalten, da die Währungskurse empfindlich und mannigfaltig in ihrer Reaktion sind. Viele Experten sind der Meinung, dass Forex als spekulatives Geschäft zumindest zu 50 Prozent von der geistigen Verfassung des Anlegers abhängt.
Zusammenfassend könnte man sagen, dass dieses Geschäft es erlaubt, in kurzer Zeit astronomische Gewinne einzufahren, besonders wenn man eine richtige Strategie entwickelt hat. Man sollte relativ viel Zeit investieren, bis man die Begrifflichkeiten versteht und über das nötige Gespür verfügt.
Tagesgeld
Als Anlageform klingt ein Tagesgeldkonto äußerst angenehm und nahezu verlockend: flexibel, unabhängig und äußerst sicher. Im Gegensatz zum Festgeld oder zum Sparbuch genießt man beim Tagesgeldkonto sehr große Freiheiten. Es können aber keine hohen Gewinne eingefahren werden, da die Zinsen nicht sehr hoch ausfallen. Aktuell sprechen nicht allzu viele Argumente für eine Anlage in Tagesgeld. Die Sparzinsen bewegen sich unterhalb der Inflationsrate, wenn man Glück hat auf dem Niveau der Inflationsrate. Im Endeffekt ist keine Wertsteigerung des Geldes derzeit möglich.
Derzeit beträgt der durchschnittliche Zinssatz bei Tagesgeldern in Österreich nicht einmal mehr 0,75 Prozent. Das Tagesgeld eignet sich womöglich nur zur Werterhaltung, und auch das nur bedingt. Es wird im 2015 keine marginale Zinserhöhung erwartet. Um diese maue Zeit zu überbrücken, könnte man ein Festgeldkonto für sechs bis 12 Monate in Betracht ziehen, um über dem Inflationsniveau zu bleiben oder das sog. Zins-Hopping betreiben. Dies ist jedoch mit einem nicht zu verachtenden Aufwand verbunden.
Festgeld
Das Festgeld ist eine solide, sichere und einigermaßen lukrative Möglichkeit. Längere Laufzeiten führen zu attraktiven Festgeldzinsen, normalerweise wirft ein fünfjähriges Festgeldkonto zwischen 2,0 und 4,0 Prozent Zinsen p.a. ab. Dafür hat man während dieses Zeitraums keine Verfügungsgewalt über das Kapital.
Aktuell ist die Lage in Österreich vor allem deshalb wenig vorteilhaft, da wir uns in einer Niedrigzinsphase befinden. Dies ist vor allem dadurch bedingt, dass der Leitzins der EZB auf einem Rekordtief ist (0,15 Prozent). Aus dem Wortlaut vom EZB-Chef Mario Draghi vor kurzer Zeit ist zu deuten, dass die Europäische Zentralbank aller Voraussicht nach nicht vorhat, den Leitzinssatz vor Anfang 2017 langsam wieder anzuheben.
Sparbuch
Sparbücher sind in Österreich beinahe schon heilig, da Sparbücher lange Zeit als Anlageform Nummer 1 galten. Heutzutage genießt diese Anlageform ein sehr zweifelhaftes Ansehen. Hohe Sicherheit ist immer an niedrige Zinsen gekoppelt.
Aktuell liegen diese zwischen 0,05 und 2,2 Prozent je nach Anlagedauer und Anlagebetrag. Wenn man die Inflationsrate betrachtet, wird man feststellen, dass kaum ein Unterschied auszumachen ist. Manchmal sind sogar die Zinssätze geringer als die Inflation. Das heißt, dass das eingesetzte Kapital an Wert verliert.
Wie sicher ist Tages, Festgeld oder Sparbuch?
Eine sichere Anlageform wird genau deshalb ausgewählt, um das Kapital zu wahren, mit Abstrichen bei der Rendite. Dafür ist die Einlagensicherung da. Es handelt sich um eine gesetzliche Vorschrift, die innerhalb der EU gilt. Dadurch sind Einlagen bis zu 100.000 Euro zu 100 Prozent abgesichert, ein Verlust ist also ausgeschlossen. Hier kann man also unbesorgt sein Geld anlegen – verzichtet aber auf die hohen Renditechancen des Forexhandels. Die Einlagensicherung betrifft sowohl das Tagesgeld- als auch das Festgeld- und das Sparbuchanlagen innerhalb der EU.
Österreichs Goldreserven
Nach offiziellen Angaben besitzt der österreichische Staat 280 Tonnen Gold. Das entspricht rund acht Milliarden Euro. 80 Prozent davon (ca. 150 Tonnen) sollen in Tresoren der Bank of England in London lagern, drei Prozent in der Schweiz und nur 17 (rund 50 Tonnen) davon befinden sich im Inland bei der Münze Österreich. Dieses Gold ist auch Gegenstand der laufenden Prüfung des Rechnungshofes (RH).
Nach Deutschland fürchtet nun auch Österreich um die Sicherheit seiner im Ausland verwahrten Goldreserven. Man zweifelt, ob das österreichische Edelmetall tatsächlich in den Tresoren der britischen Hauptstadt komplett in physischer Form vorhanden ist.
Österreich will Überprüfung der Goldreserven
Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) zwingt nun auch die Österreichische Nationalbank (OeNB) zu einer Überprüfung und Rückführung der im Ausland verwahrten österreichischen Goldreserven. Der öffentliche Druck in Österreich offenbar so groß geworden, dass der Rechnungshof im Zuge seiner Prüfung der OeNB Mitarbeiter nach London schickt, um die dort eingelagerten Goldreserven zu sichten und zu inventarisieren. Die Prüfung hat bereits stattgefunden und alles sei in Ordnung, so ein Sprecher der OeNB. So sei der Goldbestand, die Seriennummern der Barren und die Qualität überprüft.
Welche Geschäfte wickeln sich ab?
Wie nun das österreichische Portal DerStandard schreibt, ist ein Teil oder sogar der gesamte Bestand an staatlichem Gold verliehen. Es ist Tatsache, dass die österreichische Zentralbank (OeNB) durchschnittlich 30 Millionen Euro im Jahr über das Leihgeschäft mit Gold verdient. Normalerweise ist die „gold lease rate“, also das, was man für verliehenes Gold bekommt, sehr niedrig. Daraus lässt sich schließen, dass ein beträchtlicher Teil, wenn nicht der gesamte Goldbestand, verliehen sei.
Viele Notenbanken ermöglichen ausgewählten Geschäftsbanken ein lukratives Geschäft mit ihrem Gold. Die Theorie lautet: Die Banken leihen gegen Gebühr das physische Gold bei einer Zentralbank, verkaufen es am Markt und legen den Erlös verzinst an. Später kaufen sie das Gold wieder ein, um es der Zentralbank zurückzugeben.
Solange der Goldpreis fällt, ist das ein profitables Geschäft. Verluste drohen, sobald der Goldpreis rasant steigt – oder wenn am Markt nicht genügend Gold zu finden ist, um die Schuld in Form von Goldbaren bei der Notenbank wieder begleichen zu können.
Außerdem machen die Zentralbanken in ihren Bilanzen keinen Unterschied zwischen „Gold“ und „Goldforderungen“. Dabei unterscheiden sich Goldforderungen aus verliehenem Gold ganz erheblich von Goldeigentum. Wie viel Gold tatsächlich in physischer Form vorhanden ist und wie viel als Forderung an eine Gegenpartei, ist völlig unbekannt. Goldforderungen können bei einem Konkurs der Banken Not leidend werden.
Bundesbank holt immer mehr Gold nach Deutschland
Die Deutsche Bundesbank hat tatsächlich die Rückholung hunderter Tonnen aus Paris und New York eingeleitet. Deutschland will ab 2020 die Hälfte ihrer aktuell 3384 Tonnen an deutschen Goldreserven in eigenen Tresoren in Frankfurt lagern. Dazu müssen in den nächsten Jahren noch knapp 520 Tonnen aus dem Ausland nach Deutschland gebracht werden. Seit 2013 seien 67 Tonnen aus Paris und 90 Tonnen aus New York in die Zentrale der Notenbank überführt worden. Eine Lagerung in Paris ist innerhalb des Eurosystems einfach nicht mehr sinnvoll. Die Deutsche Bundesbank vertraut offenbar nicht mehr der Federal Reserve in New York.
Der Sinn der Goldreserven
Die Eurozone hat gemeinsam rund 10.000 Tonnen – und damit die größten Goldreserven. Die USA haben rund 8000 Tonnen. Gold ist ein wichtiger Teil der Währungsreserven vieler Länder und dient der Diversifikation. Neben der Diversifikation ist es eine Liquiditätsreserve und natürlich hat Gold auch eine vertrauensbildende Funktion. Im Fall eines Zusammenbruchs des weltweiten Finanz- und Währungssystems hilft einer Notenbank nur das Gold im eigenen Tresor beim Aufbau einer neuen allgängigen Währung.
Österreich gehört neben Deutschland, Finnland, Holland und Luxemburg zu den bonitätsstärksten Ländern in der Eurozone. Die Ratingagentur Standard & Poor’s stuft Österreich mit AA+ ein, Moody’s und Fitch adeln das Land jeweils mit der Bestnote Triple A – nicht zuletzt wegen seiner Goldreserven.
Das Interesse, Gold zu kaufen, hat in den letzten Monaten, vor allem aufgrund der Schwäche des Euros, zugenommen. Gold gilt seit jeher als sicherer Hafen – nicht nur für Zentralbanken, sondern auch für private Anleger.
Update 2025: Die Goldreserven haben sich zwischenzeitlich verändert. Wir werden bald dazu einen neuen Blogpost veröffentlichen!


